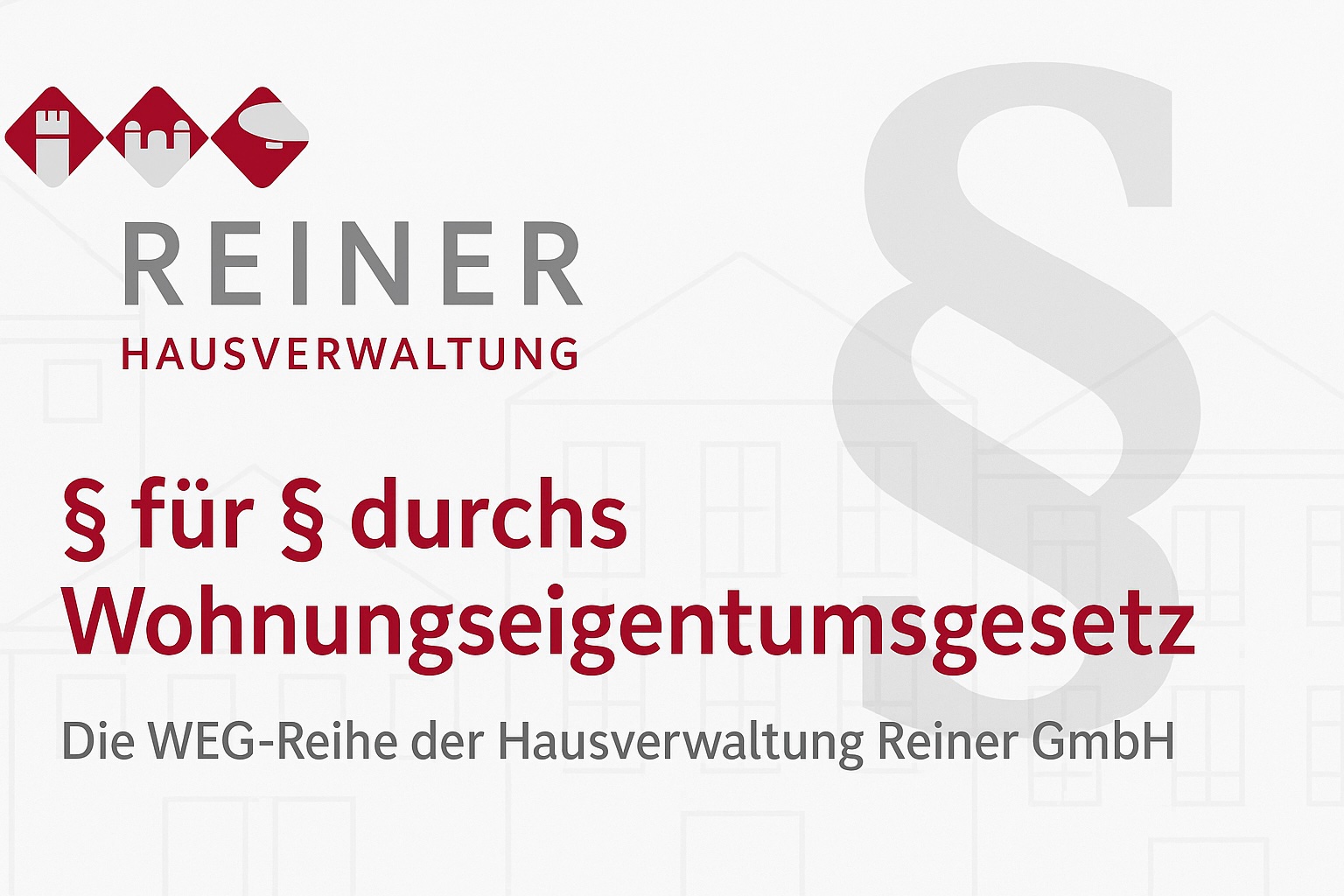§ 43 WEG (Wohnungseigentumsgesetz) – Zuständigkeit
(Aktualisiert nach der WEG‑Reform 2020; Rechtsstand: Oktober 2025; mit Praxisbeispielen für GdWE, Verwalter und Beirat)
Einleitung
§ 43 WEG regelt, wo WEG‑Streitigkeiten geführt werden: örtlich maßgeblich ist das Gericht, in dessen Bezirk das Grundstück liegt (Belegenheitsgericht). Für typische Konflikte zwischen Eigentümern, GdWE und Verwalter ordnet § 43 Abs. 2 zudem eine ausschließliche Zuständigkeit dieses Gerichts an. Damit werden parallele Verfahren an verschiedenen Orten vermieden und die Verfahren bündig an einem Standort geführt.
Gesetzestext – § 43 WEG
§ 43 Zuständigkeit
- Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer hat ihren allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen Bezirk das Grundstück liegt. Bei diesem Gericht kann auch die Klage gegen Wohnungseigentümer im Fall des § 9a Absatz 4 Satz 1 erhoben werden.
- Das Gericht, in dessen Bezirk das Grundstück liegt, ist ausschließlich zuständig für
- Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer untereinander,
- Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten zwischen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümern,
- Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten des Verwalters einschließlich solcher über Ansprüche eines Wohnungseigentümers gegen den Verwalter sowie
- Beschlussklagen gemäß § 44.
Hinweis: Maßgeblich ist die amtliche Fassung; Orthografie hier in aktueller Schreibweise umgesetzt.
Was bedeutet das in der Praxis?
- Belegenheitsgericht als Zentrum: Klagen rund um Rechte/Pflichten der Eigentümer untereinander, zwischen GdWE und Eigentümern, gegen den Verwalter sowie Beschlussklagen (§ 44) gehören zwingend an das Gericht am Ort des Grundstücks.
- Allgemeiner Gerichtsstand der GdWE: Für die Gemeinschaft selbst liegt der „Wohnsitz“ im prozessualen Sinn am Belegenheitsgericht (Abs. 1 Satz 1).
- Sonderfall § 9a Abs. 4 Satz 1 WEG: Gläubiger können Ansprüche gegen einzelne Eigentümer auch am Belegenheitsgericht erheben – zusätzliche Gerichtsstandsoption.
- Örtlich vs. sachlich: § 43 regelt die örtliche (geografische) Zuständigkeit. Welche Gerichtsart/Instanz (z. B. je nach Streitwert) zuständig ist, folgt den allgemeinen Regeln der ZPO/GVG.
- Verfahrensökonomie: Ein Gericht für alles rund ums Objekt reduziert Reibung, erleichtert Beweisaufnahme (örtliche Begehung) und vermeidet Zuständigkeitsstreitigkeiten.
Praxisbeispiele
- Hausgeldklage: Die GdWE macht Nachschuss/Hausgeld gegen einen Eigentümer geltend. Zuständig: das Belegenheitsgericht (nicht der Wohnsitz des Eigentümers).
- Beschlussklage (§ 44): Ein Eigentümer ficht den Jahresabrechnungsbeschluss an. Zuständig: ausschließlich das Belegenheitsgericht.
- Verwalterhaftung: Ein Eigentümer verlangt Schadensersatz vom Verwalter wegen Pflichtverletzung. Zuständig: Belegenheitsgericht.
- Unterlassungsklage unter Eigentümern: Nutzung als Ferienwohnung entgegen GO. Zuständig: Belegenheitsgericht.
Häufige Missverständnisse
- „Wir klagen am Wohnsitz des Beklagten.“ Bei den in Abs. 2 genannten WEG‑Streitigkeiten nicht – dort gilt die ausschließliche Zuständigkeit am Belegenheitsgericht.
- „Sitz der Hausverwaltung ist ausschlaggebend.“ Nein. Maßgeblich ist immer der Ort des Grundstücks.
- „§ 43 legt auch fest, welches Gericht (Amts-/Landgericht) zuständig ist.“ Nein. § 43 ordnet die örtliche Zuständigkeit. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus den allgemeinen Vorschriften.
FAQ zu § 43 WEG
Gilt die ausschließliche Zuständigkeit auch für einstweilige Verfügungen?
Ja, typischerweise werden Eilverfahren mit WEG‑Bezug ebenfalls beim Belegenheitsgericht geführt, weil der Streitstoff identisch ist und Beweiserhebung vor Ort erleichtert wird.
Können mehrere Streitgegenstände zusammen eingeklagt werden?
Ja, soweit prozessual zulässig (Klagehäufung), ist das Belegenheitsgericht für die in Abs. 2 genannten Streitigkeiten der richtige Ort – auch zur Bündelung.
Was, wenn die Gemeinschaft mehrere Grundstücke umfasst?
In der Praxis ist die Gemeinschaft in der Regel einem Grundbuchgrundstück zugeordnet. In Sonderkonstellationen empfiehlt sich, den Schwerpunkt der Verwaltung/Belegenheit zu bestimmen und dort zu klagen.
Wie verhält sich § 43 zu Beschlussklagen?
Beschlussanfechtungs‑ und Nichtigkeitsklagen müssen beim Belegenheitsgericht erhoben werden (§ 43 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 44 WEG). Fristen und Begründungsanforderungen regelt § 45 WEG.
Best‑Practice für Verwaltung & Beirat
- Beschlussprotokolle & Zustellung: Für mögliche Beschlussklagen die Formalien (Einladung, Protokoll, Beschlusssammlung) gerichtsfest führen.
- Gerichtsstand in Verträgen: Abweichende Gerichtsstandsklauseln mit WEG‑Bezug sind regelmäßig wirkungslos, wenn § 43 die ausschließliche Zuständigkeit anordnet.
- Belegeinsicht & Dokumentation: Saubere Aktenlage erleichtert Verfahren am Belegenheitsgericht (Belegeinsicht, Nachweise, Übergabeprotokolle).
Fazit
§ 43 WEG verankert das Belegenheitsgericht als zentrales Forum für WEG‑Streitigkeiten. Das schafft Klarheit, bündelt Verfahren und reduziert Reibungsverluste. Für Verwaltung und Beirat heißt das: Dokumentation stärken – und bei Streitfragen immer das zuständige Gericht am Objekt im Blick behalten.
Autor: Harald Reiner, Hausverwaltung Reiner GmbH
Stand: Oktober 2025
→ Weiter geht es mit: § 44 WEG – Beschlussklagen