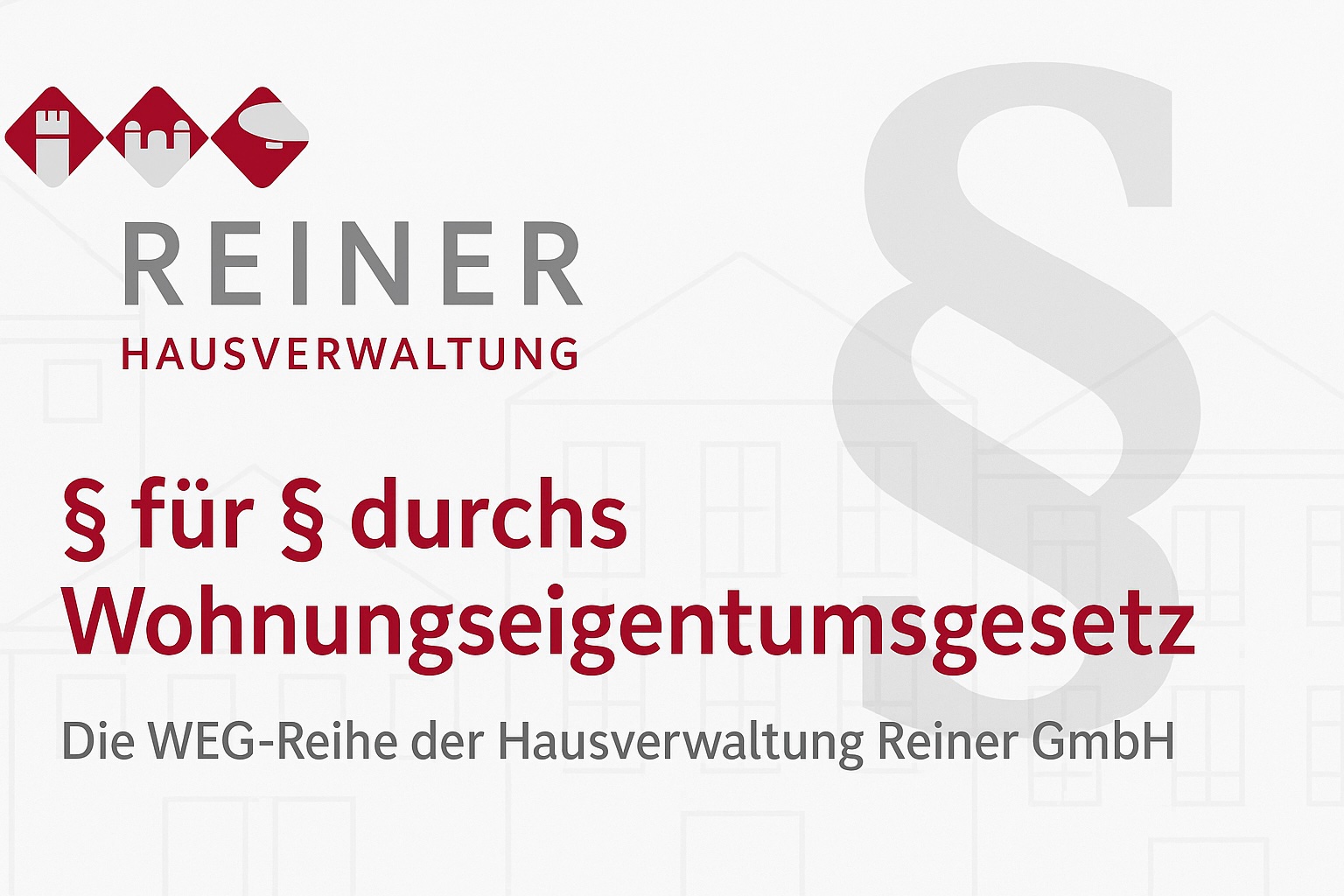§ 44 WEG (Wohnungseigentumsgesetz) – Beschlussklagen
(Aktualisiert nach der WEG‑Reform 2020; Rechtsstand: Oktober 2025; mit Praxisbeispielen für GdWE, Verwalter und Beirat)
Einleitung
§ 44 WEG bündelt die Prozessarten rund um Beschlüsse der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE): die Anfechtungsklage (Beschluss wird für ungültig erklärt), die Nichtigkeitsklage (Feststellung der Nichtigkeit) und die Beschlussersetzungsklage (Gericht fasst den unterbliebenen Beschluss). Adressat ist stets die GdWE; das Urteil wirkt für und gegen alle Eigentümer.
Gesetzestext – § 44 WEG
§ 44 Beschlussklagen
- Das Gericht kann auf Klage eines Wohnungseigentümers einen Beschluss für ungültig erklären (Anfechtungsklage) oder seine Nichtigkeit feststellen (Nichtigkeitsklage). Unterbleibt eine notwendige Beschlussfassung, kann das Gericht auf Klage eines Wohnungseigentümers den Beschluss fassen (Beschlussersetzungsklage).
- Die Klagen sind gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu richten. Der Verwalter hat den Wohnungseigentümern die Erhebung einer Klage unverzüglich bekannt zu machen. Mehrere Prozesse sind zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden.
- Das Urteil wirkt für und gegen alle Wohnungseigentümer, auch wenn sie nicht Partei sind.
- Die durch eine Nebenintervention verursachten Kosten gelten nur dann als notwendig zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 der Zivilprozessordnung, wenn die Nebenintervention geboten war.
Hinweis: Maßgeblich ist die amtliche Fassung; Orthografie hier in aktueller Schreibweise umgesetzt.
Die drei Klagearten im Überblick
- Anfechtungsklage: Greift anfechtbare Beschlüsse an (z. B. Form‑/Verfahrensfehler, Ermessensfehler, fehlende Kosten-/Tatsachengrundlage).
- Nichtigkeitsklage: Betrifft nichtsige Beschlüsse (extreme Verstöße, z. B. fehlende Verbandskompetenz, krasser Gesetzesverstoß). Nichtigkeit wirkt grundsätzlich ex tunc.
- Beschlussersetzungsklage: Wenn ein notwendiger Beschluss unterblieben ist (z. B. zwingende Maßnahme), kann das Gericht den fehlenden Beschluss ersetzen.
Verfahrensrahmen (Kurz)
- Richtige Partei: Immer die GdWE (nicht: einzelne Eigentümer oder der Verwalter als solcher). Der Verwalter informiert die Eigentümer über Klageerhebung.
- Gerichtsort: Belegenheitsgericht (vgl. § 43 WEG – ausschließliche örtliche Zuständigkeit).
- Wirkung des Urteils: Für und gegen alle Eigentümer (erga omnes innerhalb der GdWE).
- Mehrere Klagen: Sind zu verbinden (ein Verfahren).
- Nebenintervention: Kosten der Nebenintervention nur erstattungsfähig, wenn die Intervention geboten war.
Fristen & Form (Hinweis auf § 45 WEG)
- Anfechtungsklage erheben: innerhalb eines Monats nach Beschlussfassung.
- Klage begründen: innerhalb von zwei Monaten nach Beschlussfassung (Ausschlussfrist).
- Praxis: Frist läuft ab Versammlungstag; § 193 BGB (Wochenende/Feiertag) beachten. Falsche Beklagte wahrt die Frist nicht – präzise Parteibezeichnung („Gemeinschaft der Wohnungseigentümer …“).
Praxisbeispiele
- Anfechtung: Beschluss zur Jahresabrechnung mit formalen Mängeln (unzureichende Einladung/Tagesordnung) → Anfechtung innerhalb der Frist, Begründung binnen zwei Monaten.
- Nichtigkeit: Beschluss, der einem Eigentümer sein Sondereigentum „aberkennt“ → von Anfang an unwirksam (Nichtigkeitsklage zur Feststellung).
- Beschlussersetzung: Dringend notwendige Instandsetzungsmaßnahme wurde nicht beschlossen → Gericht ersetzt den fehlenden Beschluss.
Häufige Missverständnisse
- „Beklagter ist der Verwalter.“ Falsch – Beklagte ist immer die GdWE; gegen den Verwalter richten sich ggf. separate Ansprüche.
- „Begründung kann ich nachschieben.“ Die Begründung muss innerhalb von zwei Monaten vollständig vorliegen – spätere Gründe sind grundsätzlich präkludiert.
- „Bei Nichtigkeit brauche ich keine Klage.“ Achtung: Auch bei Nichtigkeitsgründen ist eine klare Klärung sinnvoll; Gerichte prüfen streng, ob die Schwelle zur Nichtigkeit überhaupt erreicht ist.
- „Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Gegners.“ Nein – örtlich zuständig ist ausschließlich das Belegenheitsgericht (§ 43 WEG).
Best‑Practice: 10‑Punkte‑Check vor der Klage
- Versammlung & Einladung prüfen (Form, Frist, Tagesordnung, Textform).
- Beschlussinhalt vs. Kompetenz/Mehrheit abgleichen; Erforderlichkeit/Ermessensausübung dokumentieren.
- Protokoll/Niederschrift und Beschlusssammlung sichern.
- Belegeinsicht organisieren (kein Erklärungsanspruch; Einsichtsrecht beachten).
- Fristen notieren: 1 Monat Klage; 2 Monate Begründung.
- Richtige Partei: „Gemeinschaft der Wohnungseigentümer [Objekt/Adresse]“.
- Gericht: Belegenheitsgericht (örtlich), sachliche Zuständigkeit nach ZPO/GVG.
- Mehrere Beschlüsse bündeln (Klagehäufung) – Verbindungsgebot beachten.
- Kostenrisiken/Nebenintervention kalkulieren (Erstattungsfähigkeit nur bei Gebotenheit).
- Kommunikation im Portal: neutrale Information an Eigentümer (Verwalterpflicht aus § 44 Abs. 2 S. 2).
Fazit
§ 44 WEG schafft klare Prozessschienen für Beschlüsse: Anfechtung, Nichtigkeit, Ersetzung – mit einheitlichem Gerichtsstand, richtiger Parteistellung und Wirkung für alle. Wer Fristen, Form und Zuständigkeiten sauber einhält, sichert schnelle Rechtssicherheit und vermeidet prozessuale Fallstricke.
Autor: Harald Reiner, Hausverwaltung Reiner GmbH
Stand: November 2025
→ Weiter geht es mit: § 45 WEG – Fristen der Anfechtungsklage