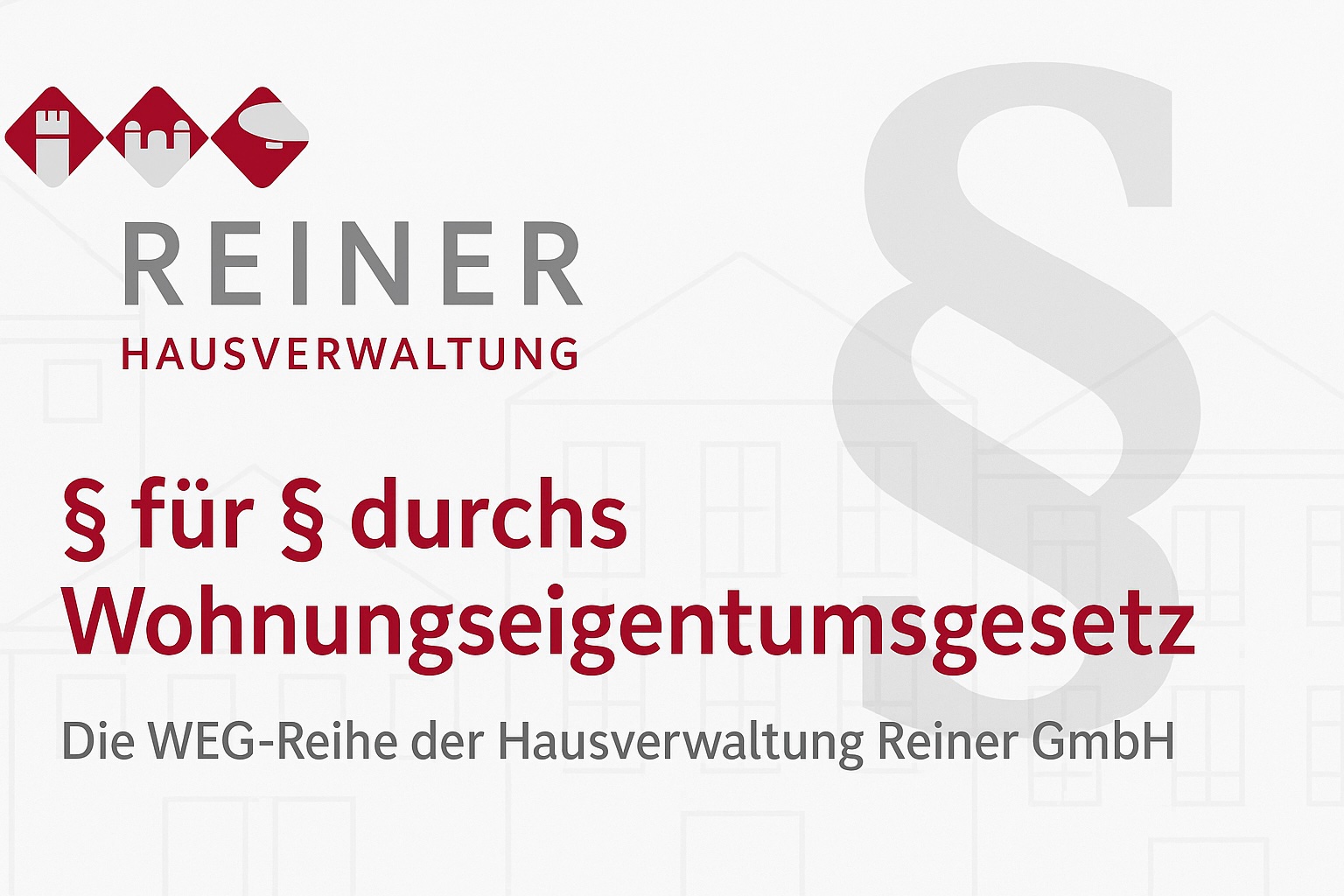§ 21 WEG (Wohnungseigentumsgesetz) – Kostenverteilung bei baulichen Veränderungen
(Auswirkungen für Eigentümer, Gemeinschaft und Verwalter nach der WEG-Reform 2020)
Einleitung
Wer trägt die Kosten, wenn die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) eine bauliche Veränderung beschließt? § 21 WEG beantwortet das – differenziert nach Art der Maßnahme und danach, wer zugestimmt hat. Der Paragraph greift eng mit § 20 WEG (bauliche Veränderungen) und § 16 WEG (Allgemeine Kostenverteilung) ineinander.
Gesetzestext von § 21 WEG (Stand 2025)
§ 21 WEG – Kostenverteilung bei baulichen Veränderungen
(1) Die Wohnungseigentümer können abweichend von § 16 Absatz 2 durch Beschluss bestimmen, dass einzelne oder alle Wohnungseigentümer die Kosten einer baulichen Veränderung ganz oder teilweise tragen.
(2) Haben die Wohnungseigentümer eine bauliche Veränderung beschlossen, die nach § 20 Absatz 1 gestattet ist, und haben nur einzelne Wohnungseigentümer der baulichen Veränderung zugestimmt, tragen nur diese die Kosten.
(3) Haben die Wohnungseigentümer eine bauliche Veränderung beschlossen, die nach § 20 Absatz 2 verlangt werden kann, tragen alle Wohnungseigentümer die Kosten nach dem Verhältnis ihres Anteils.
1) Systematik: § 21 WEG im Zusammenspiel mit § 20 und § 16
- Grundsatz (§ 16 Abs. 2 WEG): Kosten nach Miteigentumsanteilen (MEA), sofern nichts Abweichendes geregelt.
- Bauliche Veränderungen (§ 20 WEG): unterscheidet nicht privilegierte (Abs. 1) und privilegierte Maßnahmen (Abs. 2; z. B. Barrierefreiheit, E-Ladeinfrastruktur, Einbruchschutz, TK-Netz sehr hoher Kapazität, häufig auch Steckersolargeräte).
- Kostenzuordnung (§ 21 WEG): ordnet die Finanzierung je nach Maßnahme zu (nur Zustimmende vs. alle Eigentümer).
2) Nicht privilegierte Maßnahmen – wer zahlt? (§ 21 Abs. 1, 2 WEG)
Regel: Bei baulichen Veränderungen nach § 20 Abs. 1 WEG (nicht privilegiert) tragen die Zustimmenden die Kosten (§ 21 Abs. 2). Zusätzlich können die Eigentümer per Beschluss nach § 21 Abs. 1 abweichend verteilen (z. B. teilweise Mitfinanzierung durch alle).
Praxisbeispiele:
- Markisen-Sonderfarbe an der Fassade (optische Änderung, nicht privilegiert): Kosten nur für die zustimmenden/nutzenden Einheiten.
- Zusätzlicher Fahrradraum in einem Kellerteil (Komfortverbesserung, nicht privilegiert): Kosten nur für die Träger der Maßnahme – es sei denn, ein Beschluss ordnet eine teilweise/allgemeine Mitfinanzierung an.
- Dachbegrünung (ökologische Aufwertung, nicht privilegiert): Kosten der Befürworter; Mehrheitsbeschluss kann Beteiligungsquote definieren.
Wichtig: Ohne klare Kostenregelung im Beschlusstext greift der Gesetzesautomatismus (§ 21 Abs. 2) – nur Zustimmende zahlen.
3) Privilegierte Maßnahmen – alle zahlen (§ 21 Abs. 3 WEG)
Regel: Bei Maßnahmen, die ein Eigentümer nach § 20 Abs. 2 WEG verlangen kann (privilegiert), tragen alle Eigentümer die Kosten nach MEA (§ 21 Abs. 3) – auch, wenn einzelne nicht zustimmen oder die Maßnahme nicht nutzen.
Typische privilegierte Maßnahmen (gesetzlich definiert):
- Barrierefreiheit (z. B. Rampe, Treppenlift soweit baulich/brandschutzrechtlich möglich)
- Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge (z. B. Wallbox, Leitungsinfrastruktur)
- Einbruchschutz (z. B. gesicherte Hauseingänge, Riegel; optische Einheitlichkeit kann vorgegeben werden)
- Anschluss an TK-Netz sehr hoher Kapazität (z. B. Glasfaser-Hausanschluss/Steigleitungen)
- Steckersolargeräte (Balkonkraftwerke) – vielfach privilegiert eingeordnet; Details der Umsetzung (Statik, Optik, Brandschutz) können geregelt werden.
Konsequenz: Abweichende Beschlüsse zu Lasten Einzelner sind hier nicht zulässig; die Kosten treffen die Gemeinschaft insgesamt (MEA-Verteilung).
4) Beschlussgestaltung – so wird’s rechtssicher
- Klarer Maßnahmegegenstand: Was genau wird gebaut/angeschafft (Ort, Umfang, technische Spezifikation)?
- Rechtsgrundlage benennen: Verweis auf § 20 Abs. 1 (nicht privilegiert) oder § 20 Abs. 2 (privilegiert) – das steuert § 21 automatisch.
- Kostenregelung explizit formulieren: Bei nicht privilegierten Maßnahmen im Beschluss festhalten, wer in welcher Quote zahlt (z. B. nur Maßnahmenträger; oder verteilter Zuschuss).
- Folgekosten: Laufende Betriebs-/Wartungskosten mitregeln (Tragung durch Nutzer oder alle?).
- Dokumentation: Angebote, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, ggf. Alternativen, Zuständigkeiten und Zeitplan beifügen.
5) Typische Fehler – und wie man sie vermeidet
- Unklare Einordnung (privilegiert vs. nicht privilegiert) → führt zu falscher Kostentragung.
- Keine ausdrückliche Kostenklausel bei nicht privilegierten Maßnahmen → Streit, ob nur Zustimmende oder alle zahlen.
- „Falscher“ Mehrheitsglaube: Mehrheit kann bei privilegierten Maßnahmen nicht die gesetzliche MEA-Verteilung zulasten Einzelner aushebeln.
- Folgekosten vergessen (Wartung, Strom, Versicherung) → nachträglicher Streit, zusätzliche Beschlüsse nötig.
6) Praxisfälle
Fall A – Wallbox in der Tiefgarage: Privilegierte Maßnahme (§ 20 Abs. 2). Infrastrukturmaßnahme (Zuleitung/Lastmanagement) beschlossen → alle tragen die Errichtungskosten nach MEA (§ 21 Abs. 3). Individuelle Wallbox-Hardware kann per Beschluss gesondert den jeweiligen Nutzern zugeordnet werden.
Fall B – Glasfaserhausanschluss: Privilegiert (TK-Netz sehr hoher Kapazität). Anschluss samt Steigleitungen → alle nach MEA. Endgeräte in den Wohnungen ggf. individuell.
Fall C – Markisenprogramm: Nicht privilegiert. Beschluss: „Zulässigkeit & Ausführung X, Kosten nur für anbringende Einheiten“ → Tragen nur die Zustimmenden (§ 21 Abs. 2). Einheitliche Optik kann vorgegeben werden.
Fall D – Dachbegrünung: Nicht privilegiert. Beschluss bestimmt: 60 % Maßnahmenträger, 40 % Gemeinschaft (Klimaschutzargument) → Zulässig nach § 21 Abs. 1, wenn ordnungsmäßige Verwaltung nicht verletzt ist und der Beschluss eindeutig ist.
Häufige Missverständnisse
- „Wer nicht zustimmt, zahlt nie.“ Falsch. Bei privilegierten Maßnahmen zahlen alle nach MEA (§ 21 Abs. 3).
- „Die Mehrheit kann jede Kostenverteilung beschließen.“ Falsch. § 21 Abs. 3 ist zwingend; Abweichungen zu Lasten Einzelner sind hier unzulässig.
- „Ohne Kostenklausel zahlen automatisch alle.“ Falsch. Bei nicht privilegierten Maßnahmen greift § 21 Abs. 2: nur Zustimmende.
FAQs zu § 21 WEG
Gilt immer die MEA-Verteilung?
Nur im Grundsatz (§ 16 Abs. 2) und bei privilegierten Maßnahmen (§ 21 Abs. 3). Ansonsten kann/greift eine abweichende Zuordnung (§ 21 Abs. 1, 2).
Wer zahlt laufende Kosten (Wartung/Strom) einer Maßnahme?
Am besten im Beschluss mitregeln. Ohne Regelung: Auslegung nach Veranlassung/Nutzen; vermeidbare Streitquelle.
Kann die Mehrheit bestimmen, dass auch Nichtnutzer bei nicht privilegierten Maßnahmen zahlen?
Ja, über § 21 Abs. 1 – aber nur, wenn der Beschluss ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht und die Verteilung sachgerecht begründet ist.
Sind Steckersolargeräte immer privilegiert?
In der Praxis weitgehend als privilegiert behandelt; Umsetzung (Sicherheit/Optik/Statik) darf geregelt werden. Im Zweifel Rechtslage/örtliche Vorgaben prüfen.
Fazit
§ 21 WEG stellt die Kostenlogik bei baulichen Veränderungen klar: privilegierte Maßnahmen → Kosten für alle nach MEA; nicht privilegierte → nur Zustimmende, sofern kein zulässiger Abweichungsbeschluss eine andere Lastenverteilung bestimmt. Für die Praxis entscheidend sind präzise Beschlusstexte, die Maßnahme, Rechtsgrundlage, Kostenquote und Folgekosten ausdrücklich festhalten.
Verfasst von Harald Reiner, Hausverwaltung Reiner GmbH
Stand: September 2025