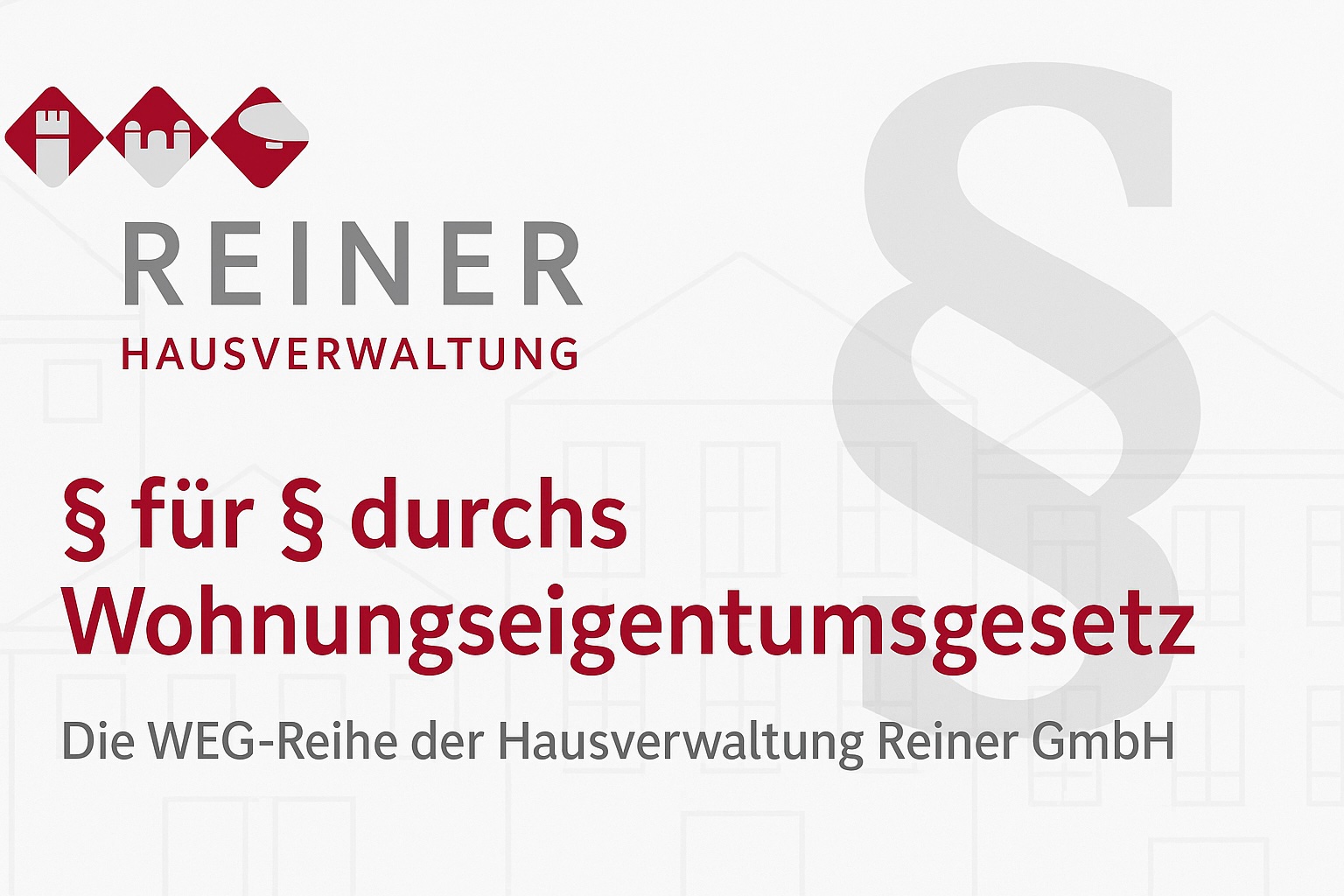§ 11 WEG (Wohnungseigentumsgesetz) – Aufhebung der Gemeinschaft
Einleitung
Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) ist auf Dauer angelegt. Ein Austritt einzelner Eigentümer oder die Auflösung der gesamten Gemeinschaft ist rechtlich nur in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich. § 11 WEG regelt verbindlich, unter welchen Voraussetzungen – wenn überhaupt – eine Aufhebung der GdWE in Betracht kommt. Ziel ist Stabilität, Rechts- und Planungssicherheit: Willkürliche Auflösungen sollen verhindert werden. Wichtige Bezüge bestehen zu § 22 WEG (Wiederaufbau) und § 9 WEG (Schließung der Wohnungsgrundbücher).
Gesetzestext von § 11 WEG (Stand 2025)
§ 11 Aufhebung der Gemeinschaft
(1) Kein Wohnungseigentümer kann die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen. Dies gilt auch für eine Aufhebung aus wichtigem Grund. Eine abweichende Vereinbarung ist nur für den Fall zulässig, dass das Gebäude ganz oder teilweise zerstört wird und eine Verpflichtung zum Wiederaufbau nicht besteht.
(2) Das Recht eines Pfändungsgläubigers (§ 751 BGB) sowie das im Insolvenzverfahren bestehende Recht (§ 84 Abs. 2 InsO), die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, ist ausgeschlossen.
(3) Im Fall der Aufhebung der Gemeinschaft bestimmt sich der Anteil der Miteigentümer nach dem Verhältnis des Wertes ihrer Wohnungseigentumsrechte zur Zeit der Aufhebung der Gemeinschaft. Hat sich der Wert eines Miteigentumsanteils durch Maßnahmen verändert, deren Kosten der Wohnungseigentümer nicht getragen hat, so bleibt eine solche Veränderung bei der Berechnung des Wertes dieses Anteils außer Betracht.
Bedeutung des § 11 WEG
§ 11 WEG macht deutlich, dass die GdWE grundsätzlich unauflöslich ist. Weder einzelne Eigentümer noch eine Mehrheit können eine Aufhebung verlangen. Selbst „wichtige Gründe“ (z. B. wirtschaftliche Schwierigkeiten, interne Konflikte) rechtfertigen keine Aufhebung. Die Vorschrift schützt alle Beteiligten – einschließlich Dritter wie Gläubiger oder Mieter – und sichert die langfristige Verwaltung und Erhaltung des Gemeinschaftseigentums.
1. Kein Anspruch auf Aufhebung (Abs. 1)
Ein individueller oder kollektiver Anspruch auf Auflösung besteht nicht. Einzige Öffnung: Eine abweichende Vereinbarung ist nur für den Fall zulässig, dass das Gebäude ganz oder teilweise zerstört ist und keine Wiederaufbaupflicht besteht. Diese Ausnahme ist eng auszulegen. Sie greift typischerweise in Fällen gravierender Zerstörung, in denen nach § 22 WEG ein Wiederaufbau ohnehin ausgeschlossen oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist.
Praxis-Hinweis: Die Vereinbarung für den Zerstörungsfall sollte in der TE/GO klar und notariell gefasst werden (z. B. Trigger „Zerstörung zu mehr als der Hälfte des Wertes“; Verweis auf § 22 WEG; Verfahren der Auseinandersetzung).
2. Ausschluss bestimmter Gläubigerrechte (Abs. 2)
Normalerweise kann ein Pfändungsgläubiger nach § 751 BGB die Aufhebung einer Bruchteilsgemeinschaft verlangen. Nicht so bei der GdWE: § 11 Abs. 2 WEG schließt dieses Recht – ebenso das entsprechende insolvenzrechtliche Recht nach § 84 Abs. 2 InsO – ausdrücklich aus. Das korrespondiert mit der in § 9a Abs. 5 WEG geregelten Insolvenzunfähigkeit des Gemeinschaftsvermögens.
3. Verteilung der Anteile im Aufhebungsfall (Abs. 3)
Kommt es ausnahmsweise zur Aufhebung, richtet sich die Quote der Miteigentümer nach dem Wert ihrer Wohnungseigentumsrechte im Zeitpunkt der Aufhebung. Wertveränderungen, die der betreffende Eigentümer nicht aus eigenen Mitteln getragen hat (z. B. Aufwertungen durch fremdfinanzierte Maßnahmen), bleiben bei der Quotenbestimmung außer Betracht – fairer Ausgleich nach Verursachung. In der Praxis sind sachverständige Bewertungen und eine saubere Kostennachweisführung entscheidend.
Abgrenzungen: Aufhebung, Wiederaufbau und Grundbuch
- Wiederaufbau (§ 22 WEG): Ist das Gebäude zu mehr als der Hälfte zerstört und der Schaden nicht gedeckt, darf ein Wiederaufbau nicht beschlossen oder verlangt werden. In solchen Konstellationen kann eine in der TE/GO verankerte Aufhebungsvereinbarung (konform zu § 11 Abs. 1 S. 3 WEG) zum Tragen kommen.
- Schließung der Wohnungsgrundbücher (§ 9 WEG): Wird Wohnungseigentum aufgehoben (z. B. einvernehmliche Aufhebung der Sondereigentumsrechte) oder vereinen sich sämtliche Rechte in einer Hand, werden die Wohnungsgrundbücher geschlossen und ein einheitliches Grundbuchblatt angelegt. Das ist nicht die „Aufhebung nach § 11“, aber ein anderer gesetzlicher Beendigungsmechanismus mit ähnlicher Folge im Grundbuch.
Praxisbeispiele
Beispiel 1: Dauerstreit in der GdWE
Mehrere Eigentümer wollen wegen anhaltender Konflikte die Gemeinschaft auflösen. § 11 WEG schließt dies aus – Konflikte sind innerhalb der bestehenden Struktur zu lösen (z. B. Verwalterwechsel, gerichtliche Klärung einzelner Streitpunkte).
Beispiel 2: Zerstörung durch Brand
Ein Feuer zerstört das Gebäude weitgehend; der Schaden ist nicht versichert. Ein Wiederaufbau ist nach § 22 WEG unzulässig. Besteht in der TE/GO eine Aufhebungsvereinbarung gem. § 11 Abs. 1 S. 3 WEG, können die Eigentümer die Aufhebung herbeiführen und das Grundstück auseinandersetzen.
Beispiel 3: Insolvenz eines Eigentümers
Trotz Insolvenz bleibt die GdWE bestehen; der Insolvenzverwalter kann die Aufhebung nicht verlangen (§ 11 Abs. 2 WEG). Die Einheit wird verwertet; die gemeinschaftsrechtlichen Strukturen bleiben intakt.
Häufige Missverständnisse
- „Wir können einstimmig beschließen, die GdWE aufzulösen.“ – Falsch. Einstimmigkeit genügt nicht; Ausnahmen nur im Zerstörungsfall mit entsprechend zulässiger Vereinbarung.
- „Bei Insolvenz eines Eigentümers endet die GdWE.“ – Falsch. Die Gemeinschaft bleibt bestehen; Aufhebungsrechte von Gläubigern sind ausgeschlossen.
- „Aufhebung nach § 11“ = „Schließung nach § 9“. – Nein. § 11 regelt die gemeinschaftsbezogene Aufhebung; § 9 betrifft die grundbuchliche Abwicklung (z. B. bei Einhand-Eigentum oder Aufhebung des Sondereigentums).
FAQs zu § 11 WEG
Kann ein Eigentümer alleine die Aufhebung verlangen?
Nein – auch nicht aus wichtigem Grund (Abs. 1).
Wann ist eine Aufhebung möglich?
Nur im gesetzlich eröffneten Ausnahmefall: Zerstörung des Gebäudes und keine Wiederaufbaupflicht; außerdem nur, soweit eine zulässige Vereinbarung dies vorsieht (Abs. 1 S. 3, Verweis auf § 22 WEG).
Können Gläubiger oder Insolvenzverwalter die Aufhebung erzwingen?
Nein – ausdrücklich ausgeschlossen (Abs. 2 i. V. m. § 751 BGB und § 84 Abs. 2 InsO).
Wie erfolgt die Verteilung bei Aufhebung?
Nach dem Verhältnis der aktuellen Werte der Wohnungseigentumsrechte; nicht selbstfinanzierte Wertsteigerungen bleiben unberücksichtigt (Abs. 3).
Was passiert grundbuchlich bei „Einhand-Eigentum“?
Vereinen sich alle Sondereigentumsrechte in einer Person, kann die Schließung der Wohnungsgrundbücher beantragt und ein einheitliches Grundbuchblatt angelegt werden; das ist ein anderer Beendigungsweg als die Aufhebung nach § 11.
Praxisbaustein: Vereinbarungsklausel (Zerstörungsfall)
„Für den Fall, dass das Gebäude ganz oder teilweise zerstört wird und keine Verpflichtung zum Wiederaufbau besteht, vereinbaren die Wohnungseigentümer gemäß § 11 Abs. 1 S. 3 WEG, dass die Gemeinschaft aufgehoben und das Grundstück nach den gesetzlichen Vorschriften auseinandergesetzt wird. Der Verwalter/Notar wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen Erklärungen abzugeben und Eintragungen zu veranlassen.“
Fazit
§ 11 WEG sichert den Bestand der GdWE und verhindert willkürliche Auflösungen. Nur im eng begrenzten Zerstörungsfall – bei fehlender Wiederaufbaupflicht – kommt eine Aufhebung in Betracht. Für die Praxis heißt das: Konflikte und wirtschaftliche Schieflagen sind innerhalb der bestehenden Strukturen zu lösen; bei Zerstörung sind TE/GO-Klauseln, Bewertungs- und Auseinandersetzungsmechanik sowie die grundbuchliche Folge (§ 9 WEG) von Beginn an sauber vorzubereiten.
Verfasst von Harald Reiner, Hausverwaltung Reiner GmbH
Stand: August 2025, es geht weiter mit § 12 WEG