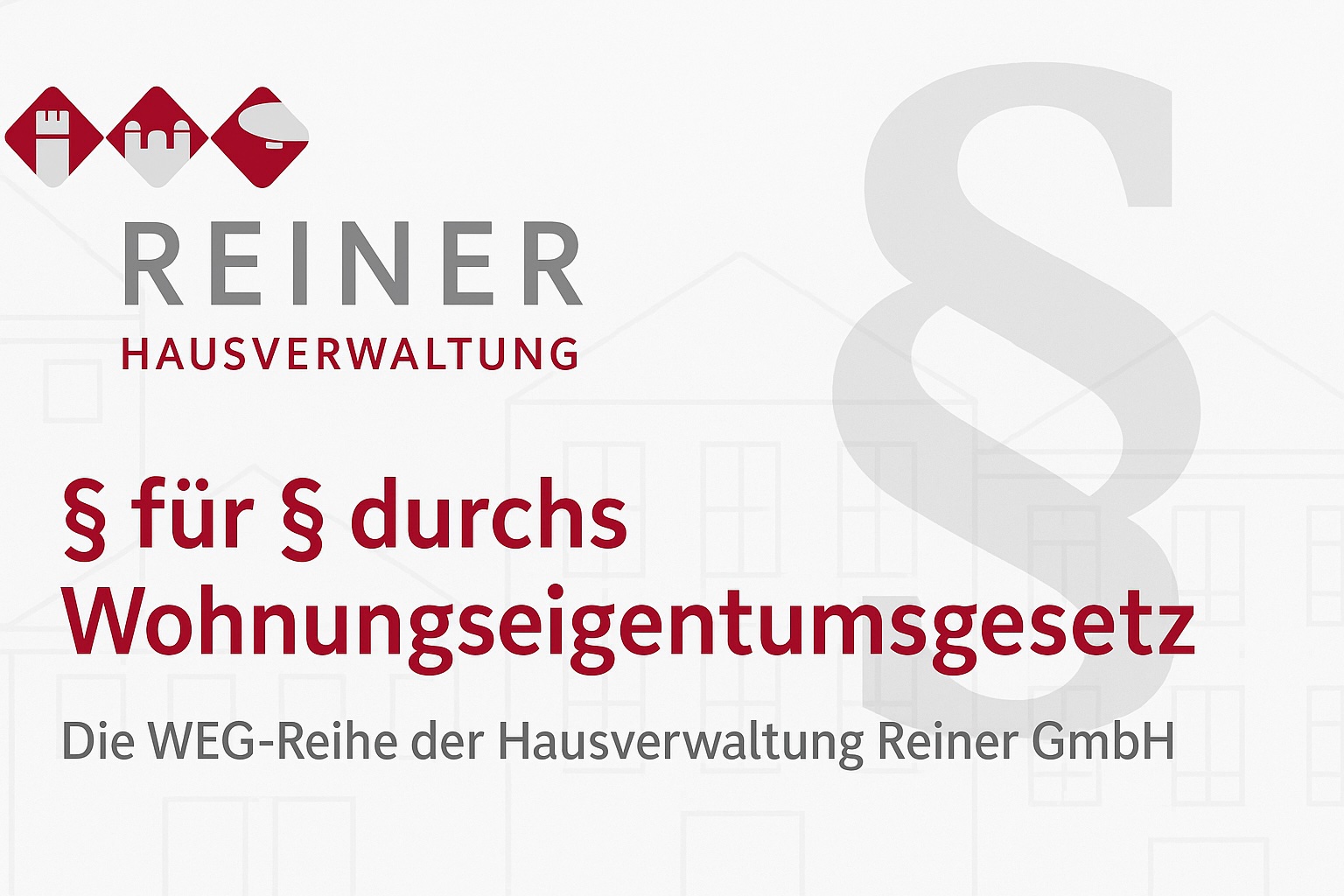§ 3 WEG (Wohnungseigentumsgesetz) – Vertragliche Einräumung von Sondereigentum
Einleitung
§ 3 WEG regelt den vertraglichen Weg zur Begründung von Wohnungs- oder Teileigentum: Bestehende Miteigentümer eines Grundstücks können vereinbaren, dass jedem von ihnen Sondereigentum an bestimmten Räumen eingeräumt wird – verbunden mit dem jeweiligen Miteigentumsanteil am Gemeinschaftseigentum. Die Norm bildet damit – neben der Teilung nach § 8 WEG – einen der beiden gesetzlichen Entstehungswege von Wohnungseigentum.
Gesetzestext von § 3 WEG (Stand 2025)
§ 3 WEG – Vertragliche Einräumung von Sondereigentum
(1) Das Miteigentum an einem Grundstück kann durch Vertrag der Miteigentümer in der Weise beschränkt werden, dass jedem der Miteigentümer das Eigentum an einer bestimmten Wohnung oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden bestimmten Räumen (Sondereigentum) eingeräumt wird. Stellplätze gelten als Räume im Sinne von Satz 1.
(2) Das Sondereigentum kann sich auch auf einen außerhalb des Gebäudes liegenden Teil des Grundstücks erstrecken, es sei denn, die Wohnung oder die nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume bleiben dadurch wirtschaftlich nicht die Hauptsache.
(3) Sondereigentum soll nur eingeräumt werden, wenn die Wohnungen oder sonstigen Räume in sich abgeschlossen sind und Stellplätze sowie außerhalb des Gebäudes liegende Teile des Grundstücks durch Maßangaben im Aufteilungsplan bestimmt sind.
Wesentliche Punkte in der Praxis
- Miteigentümer als Parteien: § 3 setzt eine bestehende Bruchteilsgemeinschaft am Grundstück voraus; die Miteigentümer schließen einen notariellen Einräumungsvertrag.
- Abgeschlossenheit & Nachweise: Für die Eintragung verlangt § 7 WEG u. a. Aufteilungsplan und Abgeschlossenheitsbescheinigung der Baubehörde.
- Außenflächen als Sondereigentum: Seit WEMoG ausdrücklich möglich (z. B. Terrassenbereiche, Außenstellplätze), solange die Wohn-/Nutzräume wirtschaftlich Hauptsache bleiben und die Flächen im Plan maßlich bestimmt sind.
- Systematik: Was Gegenstand des Sondereigentums sein kann, konkretisiert § 5 WEG; die Untrennbarkeit von Sondereigentum und Miteigentumsanteil regelt § 6 WEG; die Entstehung der rechtsfähigen Gemeinschaft bestimmt § 9a WEG.
Typische Anwendungsfälle
- Erbengemeinschaft: Zwei Geschwister halten je 1/2 Miteigentum. Durch notariellen Vertrag ordnen sie jedem Sondereigentum (Wohnung EG/OG) zu; nach Eintragung entstehen zwei Einheiten mit eigenen Grundbuchblättern.
- Bestandsobjekt mit Außenstellplätzen: Stellplätze werden als Sondereigentum begründet (nicht bloß Sondernutzungsrecht), wenn sie im Aufteilungsplan maßlich festgelegt sind.
- Terrassen-/Gartenanteile: Ein außen liegender Grundstücksteil kann Sondereigentum sein, wenn die Hauptsache „Wohnen/Nichtwohnen“ erhalten bleibt und der Bereich im Plan eindeutig vermessen ist.
Abgrenzungen & Stolpersteine
- § 3 vs. § 8 WEG: § 3 = vertragliche Einräumung durch Miteigentümer; § 8 = Teilung durch den Alleineigentümer.
- Gemeinschaftseigentum nicht „wegvereinbaren“: Bauteile, die Bestand/Sicherheit oder Gemeinschaftsgebrauch betreffen (z. B. tragende Teile, Fassade, Steigleitungen), bleiben nach § 5 Abs. 2 WEG Gemeinschaftseigentum.
- „Soll“-Vorschrift: Auch wenn Absatz 3 als „soll“ formuliert ist, verlangt das Grundbuchamt die Abgeschlossenheit und maßliche Bestimmung (Nachweispflicht gem. § 7 WEG).
FAQs zu § 3 WEG
Braucht es immer einen Notar?
Ja. Die Einräumung erfolgt notariell; erst die grundbuchliche Eintragung verselbständigt die Einheiten.
Können Außenflächen Sondereigentum sein?
Ja, wenn sie im Aufteilungsplan maßlich bestimmt sind und die Räume wirtschaftlich die Hauptsache bleiben (Abs. 2, 3).
Worin liegt der Unterschied zu einem Sondernutzungsrecht?
Sondereigentum ist dingliches Eigentum an der Fläche; ein Sondernutzungsrecht ist nur ein exklusives Nutzungsrecht an Gemeinschaftseigentum und nicht separat veräußerbar.
Fazit
§ 3 WEG bietet Miteigentümern den rechtssicheren Weg, bestehendes Gesamteigentum in eigenständige Einheiten mit Sondereigentum zu überführen. Erfolgsfaktoren sind eine saubere Vermessung, die Abgeschlossenheitsbescheinigung und eine klare Teilungserklärung. Für Verwalter und Eigentümer bedeutet das: Genauigkeit in Plan und Vertrag verhindert spätere Streitigkeiten über Zuordnungen und Befugnisse.
Verfasst von Harald Reiner, Hausverwaltung Reiner GmbH
Stand: Juli 2025 und hier gehts weiter zu §4 WEG