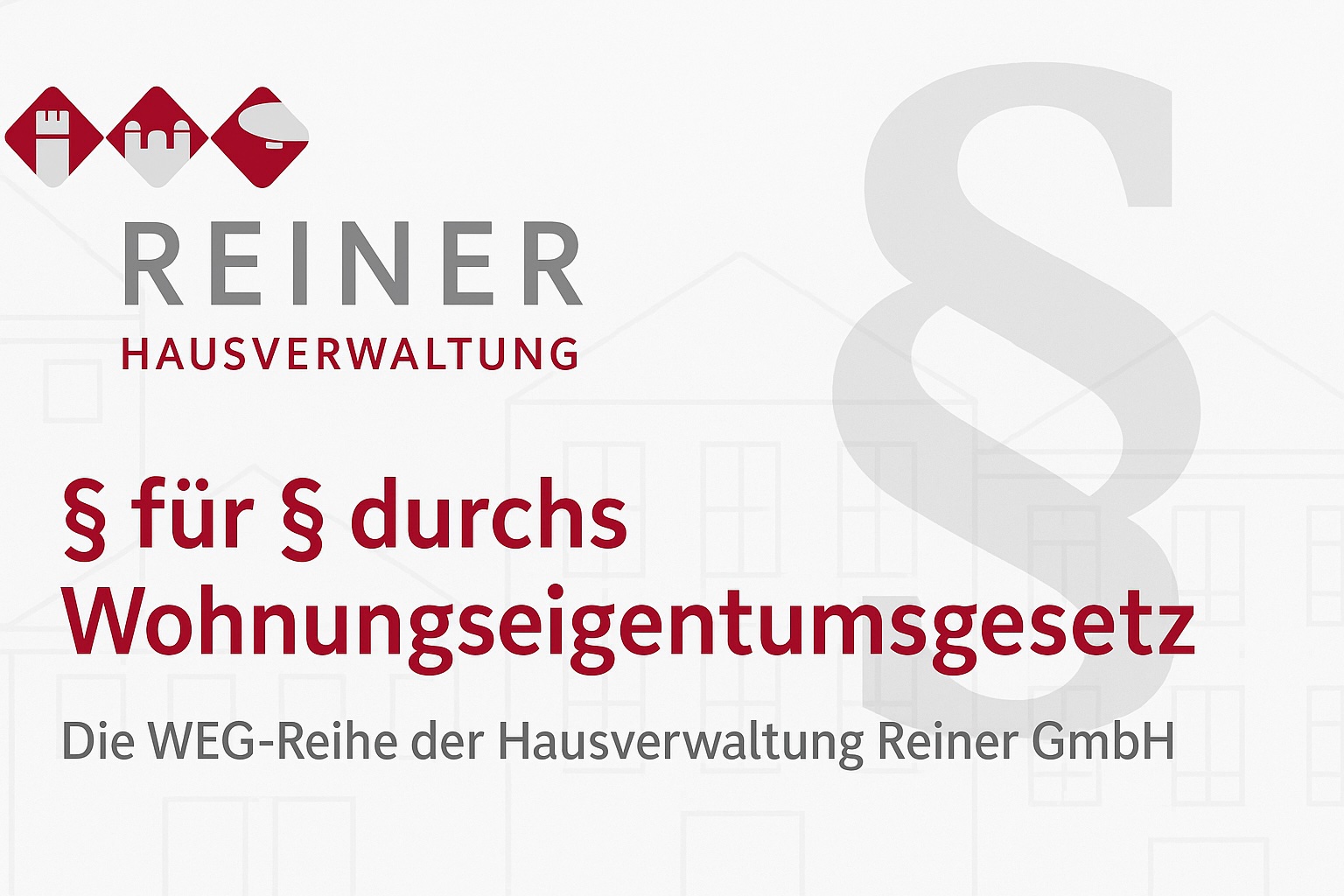§ 9 WEG (Wohnungseigentumsgesetz) – Schließung der Wohnungsgrundbücher
Einleitung
§ 9 WEG regelt, wann Wohnungs- und Teileigentumsgrundbücher geschlossen werden und welche Rechtsfolgen das hat. Praktisch relevant ist das vor allem in zwei Konstellationen: wenn Sondereigentum aufgehoben wird (Rückführung in ein einheitliches Grundstück) oder wenn sämtliche Wohnungseigentumsrechte in einer Hand zusammenfallen. Zugleich stellt die Norm klar, dass Rechte Dritter (z. B. Grundpfandrechte) gewahrt bleiben.
Gesetzestext von § 9 WEG (Stand 2025)
§ 9 WEG – Schließung der Wohnungsgrundbücher
(1) Die Wohnungsgrundbücher werden geschlossen:
1. von Amts wegen, wenn die Sondereigentumsrechte gemäß § 4 aufgehoben werden;
2. auf Antrag des Eigentümers, wenn sich sämtliche Wohnungseigentumsrechte in einer Person vereinigen.
(2) Ist ein Wohnungseigentum selbständig mit dem Recht eines Dritten belastet, so werden die allgemeinen Vorschriften, nach denen zur Aufhebung des Sondereigentums die Zustimmung des Dritten erforderlich ist, durch Absatz 1 nicht berührt.
(3) Werden die Wohnungsgrundbücher geschlossen, so wird für das Grundstück ein Grundbuchblatt nach den allgemeinen Vorschriften angelegt; die Sondereigentumsrechte erlöschen, soweit sie nicht bereits aufgehoben sind, mit der Anlegung des Grundbuchblatts.
Was regelt § 9 WEG in der Praxis?
- Schließung von Amts wegen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1): Nach wirksamer Aufhebung des Sondereigentums gem. § 4 WEG (notarielle Einigung in Auflassungsform und Eintragung) schließt das Grundbuchamt die Wohnungs-/Teileigentumsgrundbücher automatisch.
- Schließung auf Antrag (§ 9 Abs. 1 Nr. 2): Vereinigen sich alle Einheiten in einer Hand (z. B. Rückerwerb sämtlicher Wohnungen), kann der Eigentümer die Schließung beantragen.
- Schutz von Drittrechten (§ 9 Abs. 2): Bestehen Belastungen (z. B. Grundschulden) auf einzelnen Einheiten, bleiben die allgemeinen Zustimmungserfordernisse zur Aufhebung des Sondereigentums unberührt. Die Schließung ersetzt nicht die Zustimmung des Berechtigten.
- Rechtsfolge (§ 9 Abs. 3): Mit der Schließung wird ein einheitliches Grundstücksblatt angelegt; die Sondereigentumsrechte erlöschen mit Anlegung dieses Blatts, soweit sie nicht bereits aufgehoben sind.
Ablauf & Hinweise für die Praxis
- Voraussetzungen prüfen: Liegt die wirksame Aufhebung nach § 4 WEG vor oder sind alle Einheiten in einer Hand?
- Drittrechte klären: Bestehen Grundpfandrechte, Dienstbarkeiten, Reallasten? Erforderliche Zustimmungen (für die Aufhebung) rechtzeitig einholen.
- Antrag (nur § 9 Abs. 1 Nr. 2): Antrag auf Schließung über den Notar an das Grundbuchamt.
- Schließung & Neuanlage: Schließung der Wohnungs-/Teileigentumsgrundbücher; Anlage eines einheitlichen Grundbuchblatts und – wo erforderlich – Umbuchung von Belastungen nach allgemeinen Grundbuchregeln.
Rechtsfolgen im Detail
- Erlöschen des Sondereigentums: Das Objekt ist wieder ein Grundstück ohne Einheitengliederung; eine neue Begründung von Wohnungs-/Teileigentum ist nur über § 3 oder § 8 WEG möglich.
- Fortbestand/Überleitung von Belastungen: Belastungen einzelner Einheiten werden – soweit zulässig – auf das neue Blatt übernommen; Rang und Rechte bleiben gewahrt. Ohne Zustimmung des Berechtigten keine wirksame Aufhebung der betroffenen Sondereigentümerstellung.
- Sondernutzungsrechte: Sie sind regelmäßig akzessorisch und erlöschen mit der Rückführung ins einheitliche Grundstück. Nur ausdrücklich dinglich gesicherte Rechte (selten, z. B. als beschränkte persönliche Dienstbarkeit) können fortbestehen, wenn sie im Grundbuch eingetragen sind.
Praxisbeispiele
1) Alle Einheiten in einer Hand
Ein Investor erwirbt sämtliche Wohnungen. Er beantragt die Schließung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2). Das Grundbuchamt schließt die Wohnungsgrundbücher und legt ein Grundstücksblatt an; Sondereigentum erlischt.
2) Aufhebung des Sondereigentums
Die Eigentümer heben Sondereigentum gemäß § 4 WEG auf (notarielle Einigung + Eintragung). Das Grundbuchamt schließt von Amts wegen die Wohnungsgrundbücher (§ 9 Abs. 1 Nr. 1).
3) Belastete Einheit
Auf einer Einheit lastet eine Grundschuld. Ohne Zustimmung des Gläubigers ist eine Aufhebung des Sondereigentums nicht möglich; die Schließung wird zurückgestellt (§ 9 Abs. 2).
Häufige Missverständnisse
- „Mit dem Antrag entfallen Drittrechte.“ – Nein, Zustimmungserfordernisse bleiben bestehen (§ 9 Abs. 2).
- „Die Schließung wirkt schon vor der Neuanlage.“ – Falsch. Das Sondereigentum erlischt erst mit Anlegung des neuen Grundstücksblatts (§ 9 Abs. 3).
- „Sondernutzungsrechte bleiben automatisch erhalten.“ – In der Regel nicht; sie hängen am (Sonder-/Gemeinschafts-)Eigentum und gehen bei der Rückführung unter, sofern sie nicht dinglich gesichert sind.
FAQs zu § 9 WEG
Wer stellt den Antrag nach § 9 Abs. 1 Nr. 2?
Der (neue) Alleineigentümer, regelmäßig über einen Notar.
Was passiert mit eingetragenen Belastungen?
Sie werden nach allgemeinen Grundbuchvorschriften behandelt und – soweit vorgesehen – auf das neue Blatt übernommen; der Rang bleibt gewahrt.
Kann ohne Aufhebung nach § 4 WEG geschlossen werden?
Ja, aber nur im Fall der Vereinigung aller Einheiten in einer Person und nur auf Antrag (§ 9 Abs. 1 Nr. 2).
Entsteht danach automatisch wieder Wohnungseigentum?
Nein. Nach der Schließung existiert ein einheitliches Grundstück; neue Begründung nur über § 3 oder § 8 WEG.
Fazit
§ 9 WEG schafft einen klaren Abschluss, wenn Wohnungseigentum aufgehoben oder in einer Hand gebündelt wird. Entscheidend sind eine saubere Vorbereitung (Zustimmungen Dritter) und der korrekte Grundbuchvollzug: Erst mit Anlage des neuen Grundstücksblatts erlöschen die Sondereigentumsrechte.
Verfasst von Harald Reiner, Hausverwaltung Reiner GmbH
Stand: August 2025 und weiter zu § 9A WEG